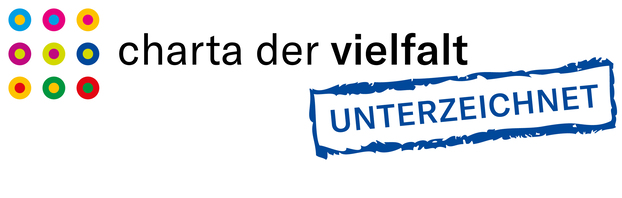Thema Verbraucherschutz Digital versichern: Darum sollten Sie wissen, was White-Label-Policen sind
Viele Versicherungen kann man bequem am PC oder per App abschließen und alle Einreichungen papierlos erledigen. Was Verbraucherinnen und Verbraucher oft nicht wissen: Bei manchen Online-Angeboten sieht man erst auf den zweiten Blick, dass das Unternehmen, unter dessen Namen das Produkt vermarktet wird, nicht der eigentliche Versicherer ist. Das Geschäftsmodell heißt White-Labeling oder Insurance-as-a-Service. Wie man solche Produkte erkennt und worauf Sie dabei achten sollten, erläutern wir hier:
Was ist eine White-Label-Versicherung?
Manche Versicherer konzipieren Produkte als Dienstleistung für Partner-Unternehmen (englisch: „insurance-as-a-service“ = „Versicherung als Dienstleistung“). Beim Vertrieb und der Verwaltung kennzeichnen sie die Produkte nicht als ihre eigenen (deshalb englisch: „white label“ = „weißes Etikett“). Stattdessen vermarkten Partner-Unternehmen die Verträge unter deren Namen. In der Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden treten im Wesentlichen die Partner-Unternehmen auf – häufig vom Vertragsschluss über die Beitragsabrechnung bis zur Bearbeitung gemeldeter Versicherungsfälle.
Aus Kundensicht ist dann manchmal nicht ganz klar, wo man versichert ist. Tatsächlich ist man eben nicht bei dem Partner-Unternehmen versichert, sondern bei einem Versicherer im Hintergrund. Dieser ist der sogenannte Risikoträger. Er übernimmt das finanzielle Risiko, das mit der Deckung von Schäden oder Verlusten aus der Police einhergeht. Wer der tatsächliche Versicherer ist, steht in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Um welche Art von Policen geht es?
Bei White-Label-Policen handelt es sich in der Regel um Produkte, die die Anbieter anhand weniger Angaben der Kundinnen und Kunden tariffieren können. Beispiele sind Tierversicherungen, Fahrradversicherungen, Hausratversicherungen und andere freiwillige Sachversicherungen. Seltener findet man eine Pflichtversicherung wie die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, freiwillige Ergänzungspakete zu Kraftfahrzeug-Versicherungen wie zum Beispiel den Drittfahrer-Schutz oder auch Kranken-Zusatzversicherungen unter den White-Label-Produkten.
Hinsichtlich der versicherbaren Risiken und der Situationen oder Schäden, die nicht abgedeckt sind, unterscheiden die White-Label-Produkte sich oft wenig von traditionellen Versicherungen. Was sie ausmacht, ist vor allem der überwiegend digitale Vertrieb und die neue Struktur der Beteiligten.
Es gibt traditionelle Versicherer, die das White-Label-Modell nutzen, um ihre Produkte über verschiedene Partner anzubieten und so einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Häufig handelt es sich bei den Versicherern aber auch um junge, technologieorientierte Unternehmen mit BaFin-Erlaubnis zum Betrieb von Versicherungsgeschäften (Insurtechs).
Im Vertrieb, also als Partner-Unternehmen, agieren ebenfalls ganz unterschiedliche Unternehmen - beispielsweise oft junge Unternehmen aus der Start-up-Szene, die allerdings keine eigene Erlaubnis für das Versicherungsgeschäft benötigen.
Die Partner-Unternehmen treten dabei regelmäßig als Versicherungsvermittler auf, die die Produkte an ihre Kunden weitervermitteln.
Wieso wichtig ist, ob es sich um White-Labeling handelt
Bei White Label-Produkten haben Sie es mit zwei unterschiedlichen Unternehmen zu tun. Informieren Sie sich gründlich über beide Partner und deren Aufgabenverteilung. Dabei sollten Sie auf folgendes achten:
- Es kann schwierig sein abzugrenzen, wofür das Partner-Unternehmen und wofür der Versicherer zuständig ist. Das gilt auch für Beschwerden. Es ist deshalb sinnvoll, sich immer an beide Vertragspartner zu wenden, also sowohl an den Versicherer als auch an das Partner-Unternehmen.
- Wie die Servicequalität ist und wie gut die Reaktion ist, wenn Sie die Police in Anspruch nehmen müssen, hängt von beiden Unternehmen ab.
- Bei Eintritt des Versicherungsfalls ist allein der Versicherer als Risikoträger verantwortlich.
Wo White-Labeling offengelegt werden muss
Auf den Webseiten oder in Apps gibt es oft Hinweise, dass es einen Versicherer gibt, der hinter dem Angebot steht. Man findet diese Hinweise allerdings oft nur in Fußnoten, im Kleingedruckten, im Impressum oder beispielsweise auch in der Rubrik „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“.
Ganz sicher gehen Sie, wenn Sie eines der folgenden drei Dokumente prüfen. Hier muss der Versicherer, der das Risiko trägt, genannt sein:
- Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB),
- Versicherungsantrag,
- Versicherungsschein.
Ist der Risikoträger nicht deckungsgleich mit dem Unternehmen, unter dessen Marke die Police vermarktet wird, handelt es sich um White Labeling.
Was Sie noch beachten sollten:
Vergleichen kann sich lohnen
Vergleichen Sie Versicherungsleistungen, Risikobeschränkungen und das Preis-Leistungsverhältnis verschiedener Produkte, auch traditioneller und White-Label-Produkte. Achten Sie dabei auch auf besondere Eigenschaften (zum Beispiel die Verfügbarkeit von Zusatzleistungen), die Ihnen wichtig sind.
Bedingungen und Ausschlüsse prüfen
Unabhängig von White-Labeling gilt: Achten Sie beim Versicherungsvergleich nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Bedingungen und Ausschlüsse in Bezug auf den Versicherungsschutz, die je nach Versicherung ganz unterschiedlich sein können. Bei Krankenzusatzversicherungen kann es zum Beispiel Wartezeiten geben, bis man bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen kann. Bei Tierkrankenversicherungen werden chirurgische Eingriffe möglicherweise nicht übernommen. Wer die Versicherungsbedingungen sorgfältig prüft, vermeidet im Versicherungsfall böse Überraschungen.
Beratung auch im Online-Geschäft
Bei digitalen Antragsstrecken gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie beim Offline-Vertrieb. Wenn Sie beraten werden möchten, scheuen Sie sich nicht, dies beim Kundenservice einzufordern. Wenn Sie unsicher sind, können Sie auch dort nachfragen, wer der Versicherer ist.
Schutz der eigenen persönlichen Daten im Hinterkopf behalten
Da bei White-Label-Produkten mindestens zwei Unternehmen beteiligt sind, müssen deren Systeme miteinander verknüpft werden, um Daten auszutauschen. Das Risiko von Sicherheitslücken und Datenverletzungen (persönliche und finanzielle Daten) kann dadurch unter Umständen erhöht sein. Achten Sie auch darauf, zu welchem Zweck Ihre Daten genutzt werden sollen. Wenn die Datennutzung über die Nutzung in dem Versicherungsverhältnis hinausgeht, sollten sie nur insoweit einwilligen, als Sie tatsächlich einverstanden sind.
Zusatzinformationen
White-Label-Geschäftsmodelle gibt es nicht nur bei Versicherern, sondern auch bei Banken. Informationen dazu finden Sie hier.